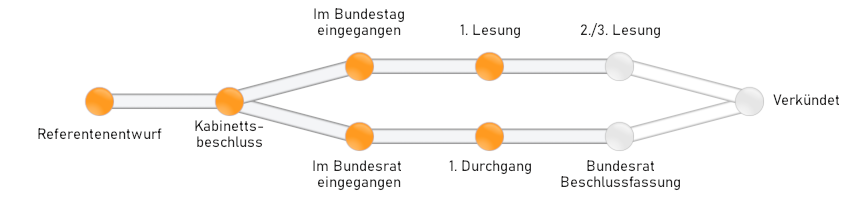Diese Zusammenfassung wurde mit GPT4 auf Basis des Gesetzentwurfs erstellt.
Basisinformationen:
Das wesentliche Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Anzahl der Aufträge und Anträge in hybrider Form bei den Vollstreckungsorganen deutlich zu verringern und die Digitalisierung der Zwangsvollstreckung weiter voranzutreiben. Dazu sollen der Anwendungsbereich bestimmter Paragraphen der Zivilprozessordnung erweitert und Regelungen für sichere Übermittlungswege im elektronischen Rechtsverkehr geschaffen werden. Zudem sollen Unklarheiten im elektronischen Rechtsverkehr und im Bezug auf Geldempfangsvollmachten beseitigt werden. Das federführende Ministerium für diesen Entwurf ist das Bundesministerium der Justiz.
Hintergrund:
Die Hintergrundinformationen zeigen, dass es seit dem 1. Januar 2022 zu einer hohen Anzahl hybrider Anträge und Aufträge kam, weil zwar Dokumente elektronisch übermittelt, die vollstreckbaren Ausfertigungen aber in Papierform vorgelegt werden mussten. Dieser Umstand führte zu Zeitverlust und Verlustrisiken. Weiterhin ist eine Verzögerung bei der Entwicklung eines bundeseinheitlichen Datenbankgrundbuchs zu verzeichnen, weshalb die Geltungsdauer einer entsprechenden Regelung zur Datenverfügbarkeit verlängert werden soll.
Kosten:
Es entstehen keine zusätzlichen Haushaltsausgaben für Bund, Länder und Kommunen. Von den Ländern wird ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von etwa 481.000 Euro erwartet. Auf der anderen Seite werden jährliche Entlastungen für die Wirtschaft in Höhe von etwa 848.000 Euro und für die Verwaltung des Bundes etwa 12.000 Euro sowie für die Verwaltung der Länder einschließlich der Kommunen etwa 620.000 Euro erwartet.
Inkrafttreten:
Keine Angaben.
Sonstiges:
Der Entwurf wird als Beitrag zur Erreichung von Ziel 16 der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung angesehen. Es scheint keine besondere Eilbedürftigkeit für diesen Entwurf zu geben. Es gibt keine alternativen Vorschläge, bis auf die langfristige Perspektive, eine digitale Lösung mit hohen Sicherheitsstandards zu schaffen, die wegen der notwendigen technischen Entwicklungen allerdings nicht zeitnah realisierbar ist. Eine Evaluierung des Vorhabens ist nicht vorgesehen, da es sich um eine Übergangslösung handelt und bereits an einer langfristigen Lösung gearbeitet wird.
Maßnahmen:
Die wesentlichen Maßnahmen des Gesetzentwurfs gliedern sich wie folgt:
- Neufassung von Regelungen zur Voraussetzung der Zwangsvollstreckung, insbesondere die Neuordnung bestehender Regelungen für eine bessere Verständlichkeit ohne inhaltliche Änderungen.
- Festlegung der Pflicht zur Versicherung einer Vollmacht innerhalb von Verfahren der Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen für bestimmte Bevollmächtigte.
- Anpassung von Regelungen zum elektronischen Rechtsverkehr mit Gerichtsvollziehern, um Unklarheiten zu beseitigen.
- Ermöglichung des direkten elektronischen Übermittlungsweges der Dokumente vom Gläubiger zum Gerichtsvollzieher unter bestimmten Voraussetzungen.
- Anpassungen im FamFG, im Arbeitsgerichtsgesetz, im Sozialgerichtsgesetz, in der Verwaltungsgerichtsordnung, in der Finanzgerichtsordnung, im Justizbeitreibungsgesetz sowie in patent- und markenrechtlichen Gesetzen.
Stellungnahmen:
Zur Stellungnahme des Bundesrates und seinen Vorschlägen zur Änderung des Entwurfs, besonders zur Streichung von § 12 Absatz 6 Satz 2 GKG zur Förderung der Digitalisierung, äußert die Bundesregierung, dass die elektronische Kostenmarke noch nicht in allen Bundesländern eingeführt ist. Eine vorweggenommene Aufhebung von Regelungen könne daher in den betroffenen Ländern zu Verfahrensverzögerungen führen. Die Bundesregierung bevorzugt daher zunächst eine Zurückstellung der Änderung, bis die elektronische Kostenmarke bundesweit einsetzbar sein wird.